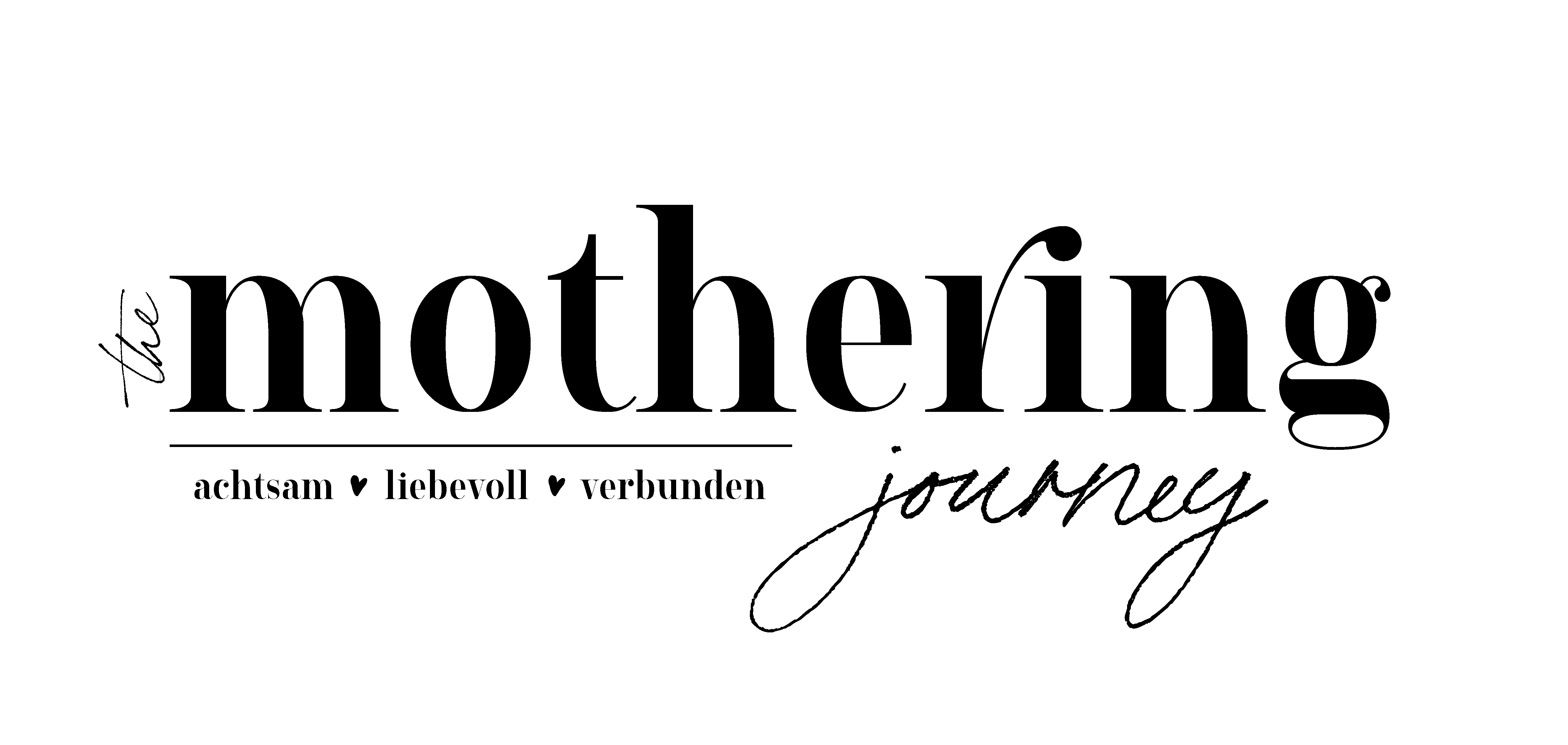Photo by Tiago Bandeira on Unsplash
Eigentlich geht es mir gut. Und dir wahrscheinlich auch. Denn wenn du das hier liest, konntest du zur Schule gehen und lesen lernen. Du hast ein Dach über dem Kopf und Strom für deinen Laptop, dein Tablet oder dein Smartphone. Du hast Internet und darfst dich frei darin bewegen. Du hast vermutlich keine großen existenziellen Sorgen, weil dir sonst Zeit oder Antrieb fehlen würden, diesen Artikel zu lesen. Du bist auf einem Blog für Mütter, also hast du wahrscheinlich selbst Kinder oder planst die Gründung deiner eigenen Familie.
Ja, eigentlich geht es uns wirklich gut. Und doch ist da dieses eigentlich.
Manchmal verstehe ich selbst nicht, warum uns das Leben so herausfordert. Man könnte meinen, wir haben doch alles. Aber noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte war alles gut oder alles schlecht. Noch nie waren alle glücklich oder alle unglücklich. Und so hat auch unsere Zeit trotz aller Errungenschaften ihre Nebenwirkungen. Auf dem Beipackzettel unser Generation stehen Einsamkeit, Entfremdung und Entwurzelung.
Wir teilen unsere überbevölkerte Erde mit 7,6 Milliarden Menschen. Und gleichzeitig ist der Schrei der Einsamkeit so laut und bedrohlich geworden, dass in England vor kurzem ein Ministerium gegründet wurde, dass Einsamkeit zum Regierungsthema macht: The Ministry of Loneliness. Premierministerin May spricht von der “traurigen Realität des modernen Lebens“. Der Mensch ist nicht alleine. Aber einsam.
Dabei sind wir soziale Wesen, für die Einsamkeit schwer auszuhalten ist. Tatsächlich stellt die soziale Isolation für uns ein erhebliches Gesundheits- und sogar Sterberisiko dar. In uns wohnt eine große Sehnsucht nach Verbundenheit. Schon immer. Dass Menschen unter Einsamkeit leiden ist also kein neuer Umstand aber dass sich Menschen {insbesondere Mütter und sogar ganze Familien} inmitten einer wohlhabenden und fortschrittlichen Gesellschaft {trotz der unendlich vielen Möglichkeiten zur Vernetzung} so einsam und isoliert fühlen, das scheint ein Phänomen unserer Zeit zu sein. Wir sind gemeinsam einsam. Gem-einsam.
Die Gründe sind bunt. Einige liegen im Außen. Andere in unserem Innersten.
Die Kleinfamilie
Wolfgang Bergmann beschreibt in seinem Buch „Warum unsere Kinder ein Glück sind“ die Kleinfamilien, in denen wir heute leben, als störanfällige Einrichtungen, die im Grunde auf sich allein gestellt sind. Keine moralische Norm, kein Verwandtschaftsbund, keine soziale Gemeinschaft bietet heute noch ausreichenden, existenziellen Schutz oder operative Hilfe. Das führt laut dem Pädagogen dazu, dass Familien zum Selbstschutz und zur Stärkung, in ihrem zarten durchschnittlich drei-bis vierköpfigen Kern noch enger zusammenrutschen und sich isolieren – so wie sie es gewohnt sind. Dabei ist das Modell der Kleinfamilie eigentlich noch ziemlich jung und wenig artgerecht.
Die Autorin Sarah Diel nennt die Entstehung der Kleinfamilie sogar einen historischen Unfall und sieht die Ursachen in der Industrialisierung und Verstädterung, dem zunehmenden gesellschaftlichen Leistungsdruck und einer – wie sie sagt – sexistischen Pädagogik, die zur strikten Teilung zwischen privatem und öffentlichem Raum führt und besonders uns Mütter isoliert. Daran können auch die neuen Medien nichts ändern, die sich zwar sozial nennen und Menschen auf unverbindliche schnelllebige Weise vernetzen aber gleichzeitig doch neue Formen der Einsamkeit, Ablenkung und Ausgrenzung schaffen.
Und vermutlich ist es nicht zuletzt auch die Wirkung dieses autarken Lebens als {digitalisierte} Kleinfamilie, dass wir Gefahr laufen, uns auch emotional von unseren Mitmenschen und sogar den eigenen Herkunftsfamilie zu entfernen. In Gesprächen mit anderen Mamas spüre ich immer wieder deutlich, dass familiäre Probleme mit den eigenen Eltern, Großeltern und Geschwistern ein sehr präsentes aber oftmals auch unausgesprochenes Thema sind. Und das macht nicht nur einsam, sondern hemmt auch unsere Heilung und Entwicklung – denn auch wenn wir längst erwachsen sind, der Einfluss und die Kraft unserer Wurzeln ist groß.
Vielleicht ist es deshalb so en vogue, die eigene Familie und Heimat für das Studium oder die Ausbildung zu verlassen. Der urbane Glitzer, das Fernweh, der Ruf der Freiheit, der Wunsch nach Autonomie oder schlichtweg die fehlenden heimischen Perspektiven: Die meisten jungen Menschen zieht es irgendwann in die Ferne und ich glaube, dass das durchaus ein wichtiger Schritt ist, um das Ende der Adoleszenz einzuläuten. Oft liegen diese Kilometer aber auch noch nach der Gründung einer eigenen Familie zwischen den Generationen – manchmal räumlich, manchmal emotional. Machmal freiwillig, manchmal gezwungenermaßen. Im Ergebnis sind wir jedenfalls meist auf uns gestellt. Während in Kanada erst kürzlich ein Gesetz verabschiedet wurde, das es bis zu vier Personen erlaubt, Eltern eines Kindes zu sein {unabhängig von Heirat und Heterosexualität, dafür aber mit denselben Rechten und Pflichten wie biologische Eltern} – tun wir uns hier zu Lande äußerst schwer damit, andere Menschen an der Erziehung oder nicht Erziehung unserer Kinder zu beteiligen. Dabei finde ich die Vorstellung, dass die Verantwortung für ein Kind auf mehreren freundschaftlich oder familiär verbundenen Schultern liegt, für alle Beteiligten sehr bereichernd. Das afrikanische Sprichwort “Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen” schmückt mittlerweile nicht nur den Baum der Erkenntnis, sondern auch etliche Blogtitel und Buchrücken – doch niemand lebt so, mal abgesehen von einigen wenigen Kommunen und Mehrgenerationen-Großfamilien.
Bindung als Basis
Ist also die Kleinfamilie an allem Schuld? Vermutlich nicht. Denn die Individualität und Isolation hat uns natürlich auch etwas gelehrt und vielleicht sogar geschenkt: Unbeugsamkeit und Freiheit. Werte, die auch ich aus meinem Leben nicht mehr wegdenken möchte. Und doch führt dies {mangels Notwendigkeit} zu einer gewissen Beziehungsunfähigkeit, die darin deutlich wird, dass viele Menschen grundsätzlich Probleme haben, eine Beziehung einzugehen oder dazu neigen, bestehende Beziehungen von störenden äußeren Einflüssen zu isolieren.
Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf unsere Kindheit und die Generation unserer (Groß)Eltern. Auch wenn es natürlich Ausnahmen gab, haben die damals gängigen Erziehungsmethoden in der Regel dazu geführt, dass viele Kinder keine sicheren Bindungen eingehen konnten. Obgleich Eltern ihre Kinder damals genauso geliebt haben wie Eltern das heute tun, wird in unserer Generation erst langsam gesellschaftsfähig, was die Bindungsforschung schon damals wusste: Kinder brauchen die Nähe und Geborgenheit der Eltern {oder mindestens einer festen Bezugsperson} damit sie Freiheit und Selbstbestimmung überhaupt ausleben können. Das klingt heute selbstverständlich, war aber damals ein {wenig propagierter} Ansatz der mit dem Wunsch nach gehorsamen, formbaren und unverwöhnten Kindern kollidierte.
Bestimmte Erfahrungen, die wir in unserer frühen Kindheit gemacht oder eben nicht gemacht haben, beeinflussen unser Urvertrauen ein Leben lang. Wer {aus welchen Gründen auch immer} keine sichere Bindung erfahren durfte, konnte für gewöhnlich auch kein Urvertrauen entwickeln und ist oft noch als Erwachsener schwerer in der Lage, selbst sichere Bindungen einzugehen. Nun sind aber genau diese Bindungsfähigkeit und dieses Urvertrauen die Basis, um tragfähige Beziehungen aufbauen zu können.
Viele Kinder mussten erfahren, dass sie nur mit Nähe belohnt werden, wenn sie die Erwartungen ihrer Eltern oder Lehrer erfüllen. Dieses Nähe-Distanz Prinzip {und die damit verbundene Konditionierung} steckt uns so tief in den Knochen, dass wir auch noch im Erwachsenenalter Schwierigkeit haben, uns vertrauensvoll zu binden und Konflikte liebevoll auszutragen. Wir trauen unseren Bindungen die notwendige Krisenfähigkeit nicht zu. Unsere Beziehungen sind nicht resilient.
Freunde, die nicht mehr in unser Leben passen, werden aussortiert und durch neue ersetzt. Das klingt vielleicht etwas theatralisch und passiert in der Realität auch eher schleichend {und oft aus guten Gründen} – aber manchmal mache ich mir wirklich Sorgen um den {austauschbaren} Wert, den wir einer Freundschaft {und Beziehung im Allgemeinen} heutzutage beimessen – und habe Angst, dass unsere Generation nicht mehr fähig ist, gemeinsam durch Krisen zu gehen. Ich frage mich, ob die unendlich anmutenden Möglichkeiten, die wir heute haben und die ich nicht missen möchte, uns teilweise unserer Kompromissfähigkeit oder -bereitschaft beraubt haben. Das Einhorn als Sinnbild für Individualität und Einzigartigkeit scheint mir nicht selten zu einem Stachel der Intoleranz und Einsamkeit zu verkümmern. Als würde die Fülle im Außen eine Leere im Inneren produzieren.
Natürlich: Was uns körperlich oder seelisch schadet, muss gehen. Unsere Kraft ist kostbar. Denn unser Leben hat es eilig. Es ist wild und wunderbar. Aber auch anstrengend. Unser Alltag: Ein möglichst effizientes Convenience Produkt. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass wir nicht jede Einladung, die eigenen Komfortzone zu verlassen, annehmen können.
Aber was Energievampir oder Energiequelle ist, wird nicht zuletzt auch von unserer Wertung, unserer Einstellung und unserer Mitbestimmung beeinflusst. Tragfähige Beziehungen tun uns in der Regel sehr gut. Nur fallen diese nicht vom Himmel. Wir dürfen an diesen Beziehungen arbeiten, Bindungen aufbauen und stärken. Und wir dürfen loslassen: Vorstellungen und Menschen gleichermaßen, wenn es wirklich unvereinbar mit unserem Wohlbefinden oder Seelenfrieden ist. Ich denke aber, dass es bereichernd und sogar heilend sein kann, zu überprüfen, ob wir manchmal nicht doch voreilig in eine Schutz- und Abwehrhaltung gehen und flüchten, statt in Beziehung zu treten.
Sehen wir einander wirklich? Reden wir genug? Hören wir zu?
Zuhören, um zu verstehen, meine ich. Nicht zuhören, um zu antworten. Sind unsere Gedanken und Gefühle bei unserem Gegenüber, wenn er spricht? Oder dreht sich das Karussell längst um unser eigenes folgendes Postulat?
Liebe als Antwort
Ich gebe zu, dass genau diese Reflexion und Auseinandersetzung miteinander in der eigenen Herkunftsfamilie besonders schwer ist. Das liegt zum einen daran, dass viele Eltern und Großeltern aus einer Generation oder Lebenskultur stammen, in der offene Gespräche über Gefühle, Gedanken oder Probleme eher untypisch oder unliebsam waren und zum anderen lastet uns selbst oftmals auch im Erwachsenenalter noch die Rolle des Kindes an. Die eigene Entelterung ist ein komplexer und schwieriger Prozess. Das Problem liegt also im System. Aber die gute Nachricht ist: Die Lösung auch.
Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen zum Thema Erziehung, Politik, Ernährung, Bildung und Ethik liefern großen Nährboden für Spannungen, Vorwürfe, Zweifel und Diskussionen. Sie schweben nicht selten als unausgesprochene Kritik über den Köpfen aller. Diese Cultural Clashes gab es schon immer und doch hab ich den Eindruck, dass solche familiären und gesellschaftlichen Konflikte früher weniger spaltend oder isolierend waren. Heute wie damals ist der Nähboden dieser Konflikte besonders fruchtbar, weil er mit Emotionen gedüngt und mit Tränen gegossen wird. Perfekt für Unkraut. Aber wo Unkraut gut wächst, gedeihen bei guter Pflege auch Blumen ganz wundervoll. Und letztlich unterscheiden sich Unkraut und Blumen ja auch nur durch unsere eigene Wertung.
Irgendwo las ich kürzlich: ‘Familie, das sind die Menschen die immer für dich da sind, dir helfen und dich lieben, selbst, wenn sie dich nicht verstehen – wofür sonst ist Familie gut?’ Eine interessante Frage, die schwierig zu beantworten ist, weil Familie komplex und zudem nicht einseitig lebbar ist. Aber eine Seite haben wir immer in der Hand. Unsere. Hier hat mich das Hawaiianische Vergebungsritual Ho’oponopono sehr inspiriert, dessen Philosophie es ist, Ängste, Vorwürfe und Ungerechtigkeiten in friedvolle, verzeihende und gütige Verhaltensweisen zu verwandeln.
Liebe als Antwort.
Und letztlich ist es ja genau das, was wir so sehr für unsere Kinder wollen und was sich im Grunde jeder Mensch wünscht: Bedingungslose Liebe. Es ist nicht immer leicht, die Unterschiede auszuhalten, aber ich denke, dass wir gemeinsam an ihnen wachsen können und dass Andersartigkeit nicht automatisch ein Ausdruck von Kritik sein muss. Wenn wir also nicht einsam sein wollen, müssen wir der Gemeinschaft wieder Raum und Zeit einräumen. In unseren Leben und in unseren Herzen. Und sollten wir wirklich an die Idee des Individualismus glauben, müssen wir lernen Vielfalt willkommen zu heißen. Und vielleicht ist das die Erkenntnis, die wir einander aber vor allem den Generationen vor und nach uns schenken können. Gemeinsam.
Dies ist eine Wortzauberei von Romy. Mehr davon bekommst du in Zukunft hier, aber auch wenn du ihr bei Instagram folgst: @slowmothering