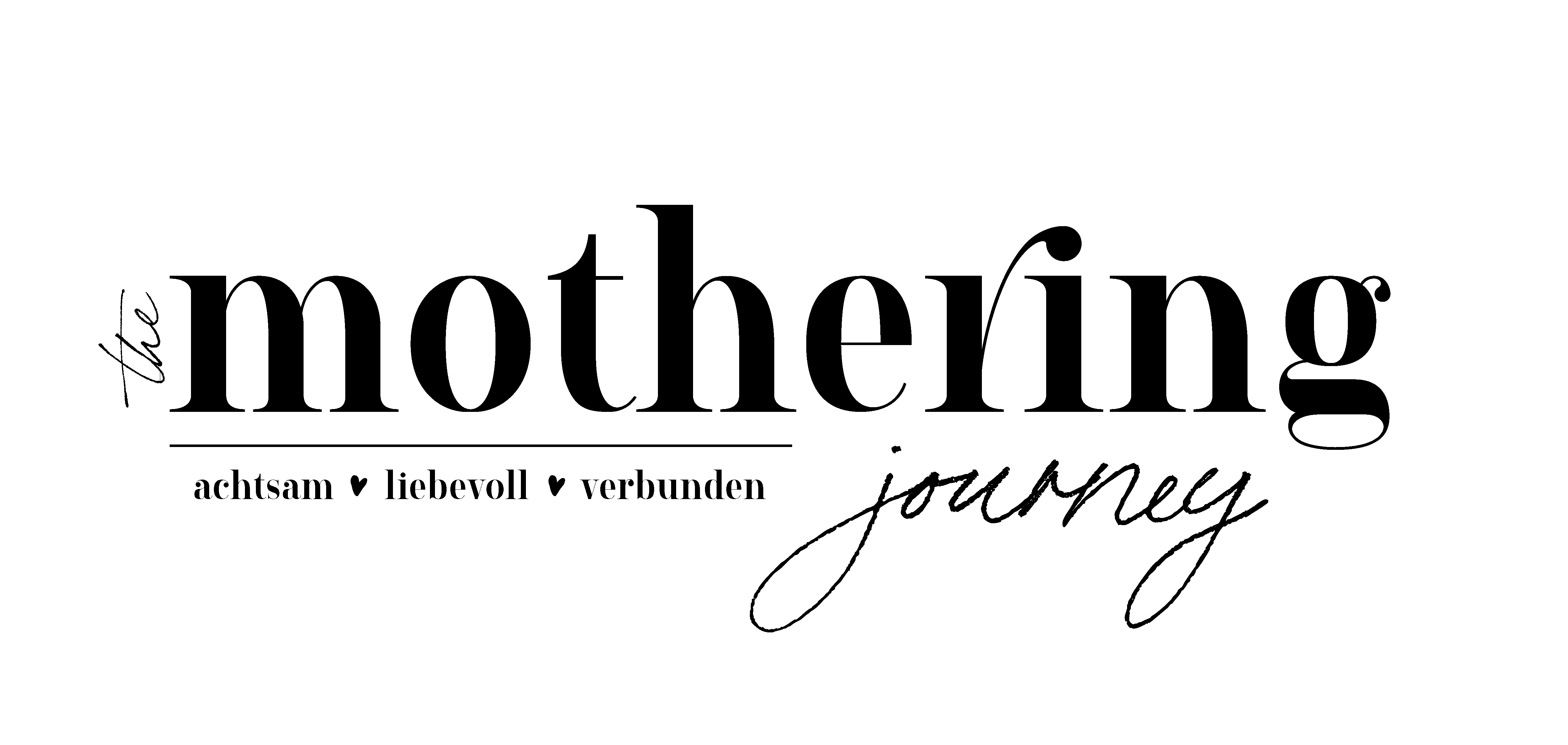Wenn ich heute mit meinen 3 Kindern dasitze und glücklich und verliebt auf mein Baby blicke, dann passiert es häufig, dass ich ein wenig sentimental werde. Ich bin so dankbar dafür, dass ich nach meinen Erfahrungen ganz unbeschwert meine 4,5 Monate alte Tochter halte, die ich ganz und gar annehmen kann und dabei vollends in meiner Mutterrolle auflebe.
Sicher wunderst du dich über mein Geschriebenes. Ist es nicht ganz normal, sich über ein Baby zu freuen und unbeschwert sein zu können? Nein, für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, da ich vor rund 6 Jahren meinen ersten Sohn bekommen habe und auf echte Muttergefühle lange Zeit warten musste. Es hat gedauert, bis ich mich getraut habe darüber offen zu sprechen und doch war es eine Wohltat, als ich mich öffnete und später sogar entschieden habe, es via Blogbeitrag “der ganzen Welt zu erzählen”.
Wie ich feststellte, passierte mir damals etwas, dass sehr vielen Frauen passiert und leider ist es auch noch heute so, dass sich nur wenige Mütter trauen darüber zu sprechen. Zu groß ist die Angst, dass man sofort als schlechte Mutter deklariert und damit symbolisch mit einem Stock in der Wunde gebohrt wird. Was ich damals hatte, waren keine gewöhnlichen Heultage – an die kann ich mich auch gar nicht erinnern. Ich war einfach überfordert. Wir hielten einen wunderschönen Sohn im Arm, aber das Einzige was ich spürte, war ein beklemmendes Gefühl und die Angst alles gar nicht zu schaffen.
Ich habe nicht einmal gemerkt, dass da was schief lief …
Aus dem jetzigen Blickwinkel lässt sich alles recht einfach erklären und ich erkenne viele Auswege, die ich damals gehabt hätte. Das Fiese ist: Man merkt in dem Moment nicht, dass man in eine postpartale Depression hinein schlittert. Natürlich gab es Anzeichen; ich empfand den Tag als anstrengend; ich war antriebslos; ich war müde und ich fühlte mich sofort schlecht, wenn ich alleine mit meinem Kind war. Aus mir sprühte die pure Überforderung und doch wusste ich stets gute Miene zu machen, wenn mich jemand fragte, wie es nun als Mutter so sei. “Toll!”, antworte ich. Schließlich war ich der festen Annahme, dass man solche Aussagen von mir erwarten würde. Fehlende Muttergefühle bemerkte ich in jener Zeit auch nicht; schließlich wusste ich nicht, wie sich echte Mutterliebe anfühlte. Auch wenn ich heute diese Zeilen tippe, fällt mir immer wieder auf, wie blöd sich das anhört – keine Mutterliebe, aber doch: genauso war es.
Ich lebte also mit meinem Kleinen zusammen, ich mochte ihn, ich wollte ihn auch bei mir haben, aber diese tiefe innige Liebe, diese tiefe Verbundenheit, die ich heute zu ihm und auch den anderen beiden Kinder spüre, die hatte ich damals einfach nicht. Was der Fehler war, warum es mir so erging und wieso es so gekommen ist, kann man nur munkeln. Vermutlich war ich erschrocken über die Verantwortung, die ich plötzlich hatte und ich stand mir selbst im Wege, da ich viel zu hohe Ansprüche an mich als Mutter setzte. Ich laß schon während der Schwangerschaft viel zu viele Bücher und wollte alles bestmöglich umsetzen. Das Kind mit in mein Bett zu nehmen war unvorstellbar. Ich hatte Angst, es stirbt. Also schaukelte ich ihn lieber 4 h durch die Wohnung bis er erschöpft einschlief und ich mit einem Gefühl des Versagens ins Bett ging. Der Alltag war eintönig, wir lebten damals in einer Mietwohnung auf einem Dorf. Ich hatte kaum Kontakte und je mehr ich mir meiner Probleme bewusst wurde, umso mehr mauerte ich und lullte mich ein. Nach außen hin, verkörperte ich aber weiterhin die alles schaffende, stets gut gelaunte Mutter. Das alles war falsch. Das wusste ich damals aber nicht.
Der Wendepunkt
Als mein Sohn ungefähr ein Jahr alt war (es ist noch heute eine schlimme Vorstellung, dass ich ein Jahr einfach so “daher lebte”) gab es einen Wendepunkt. Mein Mann war genervt, weil ich ihn ständig auf Arbeit anrief und ab 14 Uhr schrieb, dass er nach Hause kommen sollte, weil ich so geschafft bin. Wir stritten oft und die Reaktion war, dass er noch länger arbeitete und ich mich allein gelassen fühlte. Irgendwann eskalierte die Situation und die Trennung war nahe bis er mich vor die Wahl stellte zu gehen. Zu gehen, würde bedeuten: weg von ihm, weg von meinem Kind, weg von allem – es wäre ein Flucht gewesen und doch wurde mir in diesem Moment klar, dass mein Leben gerade zerbröckelt und alles in Scherben liegt. Ich weinte und ich beruhigte mich kaum, drückte mich an meinem Mann und traute mich endlich, mich ihm anzuvertrauen. Ich erzählte, dass es mir schlecht geht, dass alles komisch sei und dass ich aus der Wohnung raus muss. Es folgte daraufhin eine Zeit voller Veränderungen. Wir gingen das Problem gemeinsam an. Da ich inzwischen wieder arbeitete, ließ ich mich erst einmal krankschreiben. Wir suchten eine neue Wohnung, wir redeten viel und wir wollten bei Null anfangen. Ich holte mir Unterstützung und bat aktiv um Hilfe bei der Betreuung meines Sohnes. Alle Ratgeber, Zeitschriften und Magazine, die perfekte Mutterbilder inszenierten, wanderten in die Tonne. Ich fing an zu bloggen und empfand es als Wohltat ehrlich über Probleme sprechen zu können und meine Kreativität über unseren Blog auszuleben. Eines abends lag ich mit meinem Sohn dann im Bett und kuschelte und ich war mir sicher: DA sind sie, die lange vermissten Muttergefühle.
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mir selbst im Weg stand. Die ganze Zeit wollte ich perfekt sein und machte umso mehr unperfekt. Ich setzte meine eigene Ehe aufs Spiel und ich riskierte sogar meine Bindung zu Mann und Kind ohne es zu merken. Es war ein glücklicher Umstand, dass mein Mann das Problem irgendwann erahnte und sich mir annahm. Nun möchte ich mit meiner Offenheit einen Teil dazu beitragen, dass es gar nicht mehr so weit kommen muss: Es muss aufhören, dass man sein Bauchgefühl und Instinkt untergräbt, nur um den Ratgebern zu entsprechen. Es muss aufhören, dass man sich direkt schlecht fühlt, wenn man es anders macht und es muss aufhören, dass man Angst hat mit Problemen in die Öffentlichkeit zu treten. Ich kann schwer beschreiben, wie man selbst erkennen kann, dass man gerade in eine nachgeburtliche Depression hinein schlittert, aber wenn du selbst eine Leere in dir spürst und dich selbst nicht richtig erkennst: Vertrau dich jemanden an und lass dir helfen! Keiner wird dir den Kopf abreißen und niemand wird dir dein Kind deshalb nehmen.
Als vorbeugende Maßnahmen kann ich nur empfehlen, sich schon in der Schwangerschaft selbst zu vertrauen und in sich hinein zu hören. Ich bin bei meinen beiden anderen Kindern wesentlich gelassener gewesen und habe viel mehr auf mich und mein Gefühl vertraut, als darauf, was mir irgendwelche Menschen erzählen möchten, die mein Kind überhaupt nicht kennen und mich nicht einschätzen können.
Sabrina
DAS PRINT-MAGAZIN

Sabrina bloggt zusammen mit Bianca für „Mamahoch2“ – einem quirligen Mamablog, der sich verschiedenen Themen in der Kreativsparte, dem Familienleben und kindorientiertem Leben widmet. Neben brisanten Erziehungsfragen und ehrlichen Alltagsberichten schneiden die beiden auch mal kritische Fragen an und wollen ihre Leser zum Nachdenken animieren … Kostenfreie Schnittmuster und kreative Anleitungen zum Nachmachen runden ihren Blog ab.
HIER findet ihr Sabrina: www.mamahoch2.de
Titelbild: Adobe Stock © Mallivan