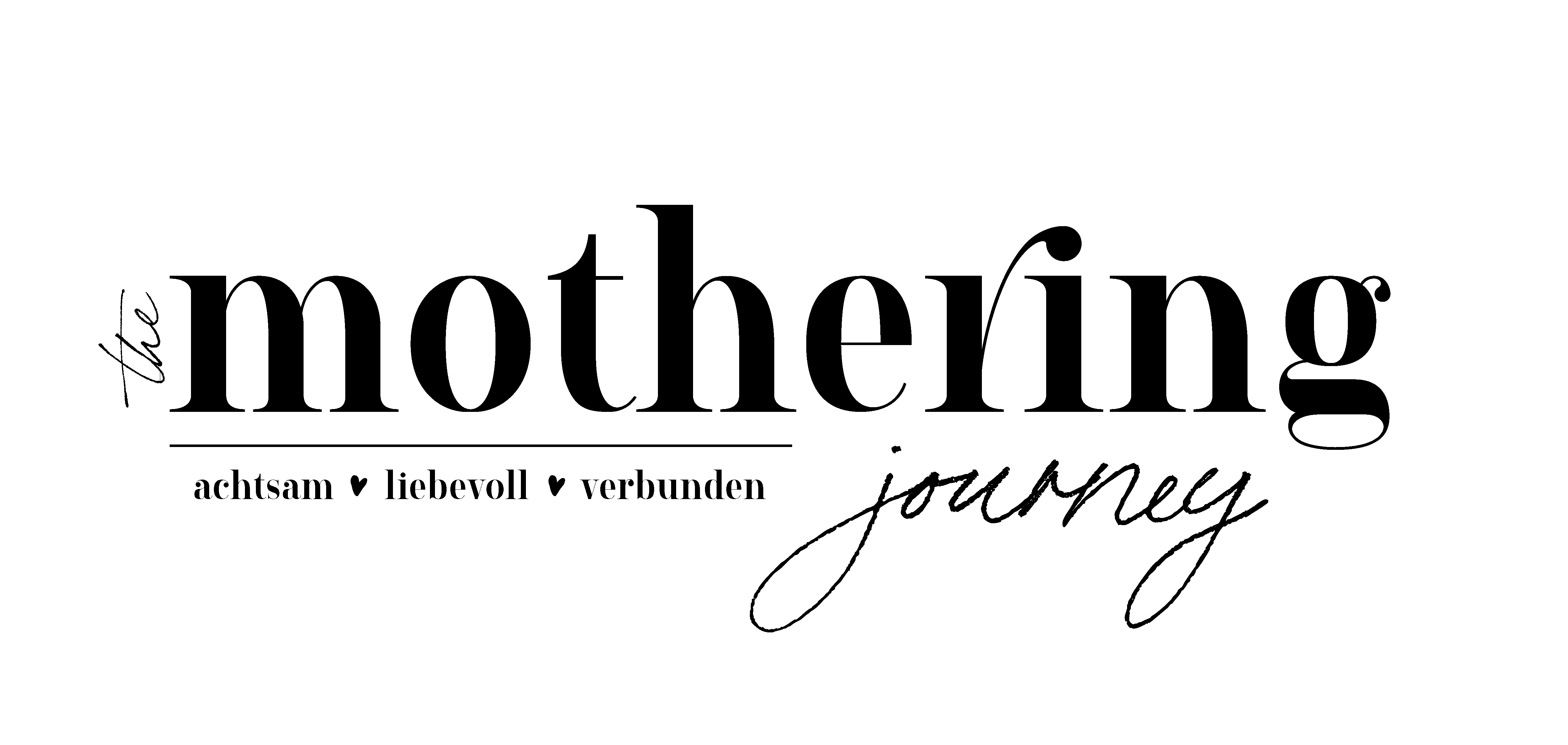Foto von Birka Gleichmann | Via Photo
Einige Momente im Leben verlieren nichts an ihrer Intensität, selbst wenn aus dem Augenblick längst eine Erinnerung geworden ist. Zehn Jahre ist es her. Aber ich erinnere mich noch immer fühlbar an den Tag, an dem ich mit meinem Baby zum ersten Mal nach Hause kam.
Als ich die Treppen zu unserer Wohnung im ersten Stock hinauf ging, zitterte ich leicht vor Aufregung und meine feuchten Hände klammerten sich fest um den Griff der Babyschale. Da waren wir also. Zu dritt. Zu Hause. Eine richtige Familie.
Meine Gedanken schossen wie Querschläger durchs Treppenhaus und ich konnte meine eigenen Schritte kaum hören, weil mein Herz so laut pochte. Als ich diese Wohnung vor drei Tagen verließ, pochten noch zwei Herzen in mir, dachte ich. Damals war ich unfähig zu denken. Ich erinnere mich kaum daran. Mein Körper hatte in eine Art Automatikmodus gewechselt, dessen einzige Aufgabe es war, dieses kleine Zauberwesen sicher zur Welt zu bringen.
Mit den Wehen begann auch dieser nebelige Trancezustand, der mich damals durch die ersten Tage meiner Mutterschaft trug.
Dieses Baby veränderte alles. Noch nie zuvor hatte ich etwas gesehen, dass so absolut und gleichzeitig so zerbrechlich war. Es war überwältigend. Aber auch beängstigend.
Mit meinem Sohn zog diese ungewöhnliche Stille ein. Eine Stille, die so laut war, dass mich jedes zarte Seufzen oder Wimmern ehrfürchtig zusammenzucken ließ. Ich lag auf der Lauer und konnte die Anspannung in jeder Pore meines unbewohnten, postnatalen Körpers spüren.
Mein eigenes Zuhause fühlte sich plötzlich völlig fremd an. Sogar die Wohnung. Obwohl wir nun zu dritt hier lebten, wirkte sie in dieser sensiblen ersten Zeit viel größer auf mich. Ich fühlte mich darin verloren. Haltlos. Die Verbindlichkeit dieser nach Baby duftenden Veränderung raubte mir den Atem. Und obwohl ich unsagbar stolz und glücklich war, spürte ich eine heiden Angst. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommen würde. Was es heißt, Mutter zu sein. Oder wie man sie trägt, diese Verantwortung. Ohne unter ihrer Last zusammenzusacken. Und obwohl ich so viele Fragen hatte, beschloss mein mütterlicher Instinkt, sich vorerst zurück zu ziehen. Um anzukommen im neuen Leben.
Die Einsamkeit klopfte leise an.
Ich versuchte, sie nicht hinein zu lassen. Weder in mein Herz, noch in meine Wohnung. Doch in Zeiten, wo aus Rücksicht und Unsicherheit sonst kaum jemand an die Tür klopfte, konnte sie sich leichten Zutritt verschaffen. Ich vermisste dieses Gefühl von Geborgenheit, das eine Mama durchs Wochenbett tragen kann. Doch dank meiner wundervollen Hebamme wuchs in mir schnell das Vertrauen und die Zuversicht, dass ich bereit war. Auch wenn ich noch immer nur den Hauch einer Ahnung hatte, wofür.
Wenn ich heute daran zurück denke, fühlt es sich an, als stammten diese Erinnerungen aus einem ganz anderen Leben. Und von einem ganz anderen Menschen. Zehn wundervolle Jahre liegen zwischen damals und heute. Zehn Jahre, zwei weitere Kinder und unendlich viele Momente und Erfahrungen. Schöne und krasse gleichermaßen. Das erste Wochenbett meines Lebens war intensiv und forderte mich heraus. Es war ein wahrer Entwicklungsbeschleuniger und doch wirkt es im Vergleich zu dem was noch kommen sollte blass. Es war erst der Beginn einer Reise, die alles wie einen Martini durchschüttelte, neue Perspektiven ermöglichte und klare Prioritäten setzte. Ich glaube, alle Mütter betreten mit der Geburt ihrer Kinder eine ungeahnte Dimension der Gefühlstiefe und -vielfalt.
Du blickst der Urangst ins Auge. Der Urkraft. Und der Urliebe.
Ich habe Erfahrungen gemacht, an die die Frau die ich war, bevor ich Mama wurde, keinen Gedanken verschwendet hat. Heute weiß ich, was es bedeutet neben deinem narkotisierten Kind im Aufwachraum zu sitzen und seine Hand zu halten. Wie es sich anfühlt, augenblicklich mit ihm tauschen zu wollen, aber es nicht zu können. Oder wie es ist, wenn die Erkenntnis, dass nur eine Prise Glück zwischen dir selbst und dem Tod stand, dein Herz durchbohrt, weil du im dritten Wochenbett unbemerkt eine lebensbedrohliche Anämie hattest. Nie vergesse ich dieses Kribbeln im Körper, dass dich die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit allen Lebens spüren lässt. Ich verstehe, dass alltäglich erscheinende Probleme dir die Füße in Zement gießen können. Ich kenne das Herzgebreche, wenn du dein weinendes Kind in die Kita bringen musst – obwohl dein Mutterinstinkt laut aufschreit – doch dein Job davon abhängt. Ich weiß um die schlaflosen Nächte, die dir den Verstand rauben. Und nie vergesse ich die Schockmomente, wenn du siehst, wie eins deiner Kinder einen Unfall hat. Oder den Schmerz der Ohnmacht, der dir die Kehle zuschnürt, wenn dir klar wird, dass du dein Kind nicht vor allem oder jedem beschützen kannst.
Die Verantwortung würde mir wohl den Atem rauben, wenn die Liebe zu meinen Kindern es nicht schon längst getan hätte.
Denn was ich heute eben auch weiß ist, wie leicht und erfüllend sich all das anfühlen kann, wenn sich dabei zwei kleine Arme um deinen Hals legen. Ich glaubte immer daran, dass Kinder das Leben bereichern. Deshalb wollte ich mindestens zwei. Und ich glaubte auch, dass ich sie über alles lieben würde. Doch was ich wirklich zu fühlen im Stande bin, das haben mir erst meine drei Kinder gezeigt. Sie haben meinen Blick auf so ziemlich alles verändert. Nicht zuletzt auch den Blick auf mich selbst.
Nach diesem ersten Jahrzehnt als Mama schaue ich zurück. Stolz. Ehrfürchtig. Vorfreudig. Und ich denke nicht, dass ich etwas an meinem bisherigen Weg ändern oder Erfahrungen weglassen würde, selbst wenn ich es könnte.
Einzig die Erkenntnis, dass mein Mama-Ich von einem regenbogenbunten, kuntergrau-glitzernden Schatten der Erfahrung begleitet sein wird – sowie die Gewissheit, dass dieses ganze Potpourri an mütterlichen Emotionen völlig normal ist – hätte ich gern früher mit auf meine Reise genommen.
Liebe Mama, was auch immer du gerade fühlst – es ist vergänglich. Und obgleich ich mir die Ewigkeit manchmal herbeisehne, weiß ich doch, dass es diese Vergänglichkeit ist, die unserem Leben und jedem Moment darin seine Bedeutung verleiht. Und so versuche ich, jeden Moment – jedes erste und jedes letzte Mal – bewusst zu erleben.
So wie jetzt gerade. Während ich das hier schreibe, sitze ich im Bett. Neben mir schläft meine Tochter und ich kann hören, wie sie leise und gleichmäßig atmet. Vor unserem Fenster schwankt die große Tanne, unter der sie sich so gern versteckt, wie trunken durch die Dunkelheit. Die Nacht wirkt friedvoll. Und still.
Da ist sie wieder. Ich kann sie hören. Doch dieses Mal genieße ich die Stille.